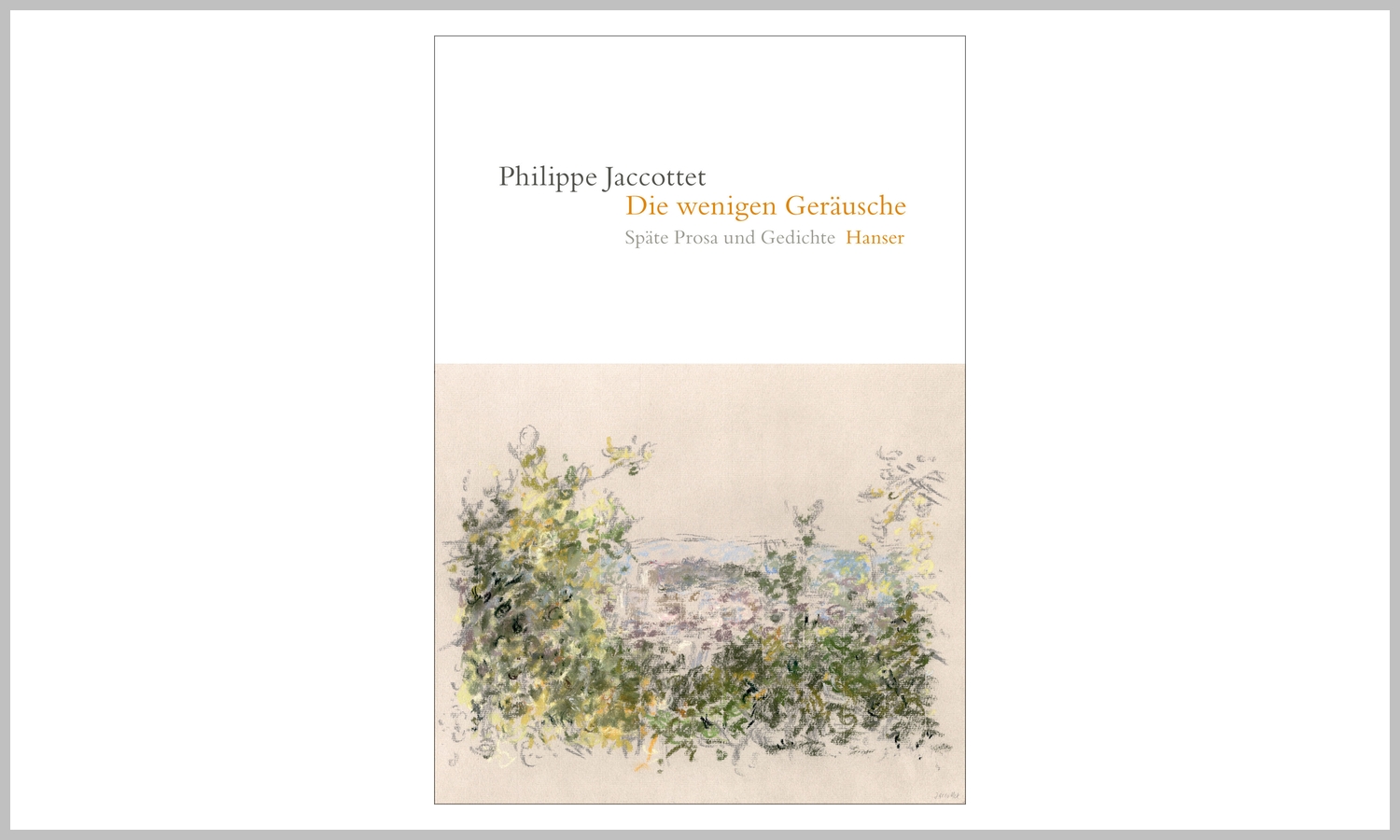Philippe Jaccottet: Die wenigen Geräusche
Im Hanser Verlag sind die späten Gedichte, Aphorismen und Textskizzen von Philippe Jaccottet erschienen.
Übersetzt wurden sie erneut von Wolfgang Matz und Elisabeth Edl. Die beiden Übersetzer, die eine Meisterleistung abliefern, informieren im Nachwort über die Textgestalt, die kurz vorab erläutert sei. Versammelt sind im neuen Buch vier Zyklen von Philippe Jaccottet. Sie bilden den Abschluss seiner Pléiade-Ausgabe bei Gallimard.
Philippe Jaccottet und das Altern
Wüsste man das nicht, würden sich die Texte in der neuen deutschen Fassung aber auch problemlos wie ein einzelner, vielleicht etwas stärker unterteilter Zyklus lesen. Derart zusammengehörig wirken die Texte Jaccottets. Denn sie reden allesamt vom Altern und Sterben – und zwar als wäre es das Natürlichste was es gibt. Bei Jaccottet haben die Texte über das Altern und die Natur nämlich eine enorm enge Beziehung.
Diese Verbindung äußert sich für Jaccottet in den simpelsten Momenten, die einfach geschehen: „Jede Blume, die sich öffnet, öffnet mir gleichsam die Augen. In der Unaufmerksamkeit. Ohne Willensakt vom einen oder vom andern.“ (S. 75) Die Gewissheit des bloßen Lebens ist ihm eng verbunden mit gelungener Literatur. Auch deshalb steht wohl in einem seiner eingefügten Versgedichte:
Hielte das Licht die Feder,
S. 100
atmete die Luft selbst in den Worten,
so wäre es besser.
Besser ist diese Art von Wirklichkeit vor allem als die Wirklichkeit von Verzweiflung angesichts der menschlichen Sterblichkeit. Diese will Philippe Jaccottet, das ist eines der Leitmotive, so gut es ausblenden, aber natürlich befasst er sich gerade deshalb ständig mit ihr. Dafür sucht er Trost nicht nur in der direkt verfügbaren Natur, sondern auch in der Literatur. Er befasst sich auf intime Weise mit Großen wie Henry David Thoreau, Franz Kafka oder Johann Wolfgang von Goethe.
Vor allem Kafka scheint in den düsteren Momenten ein nicht zu verdrängendes Vorbild zu sein. So schreibt Jaccottet an einer Stelle vom Leben als etwas, das undurchdringlicher sei als ‚bloß‘ ein Labyrinth – denn „dort reichte schließlich ein bisschen Geduld, und man fände den Ausgang“. Im Leben aber ist der Mensch existenzieller „verirrt, weil weggebracht in einen anderen, entstellten Raum, verirrt in abgelegene Gegenden und ohne Hoffnung, dass jemand je bis hierher kommen könnte und Hilfe bringt.“ (S. 41)
Die wenigen Geräusche der Literatur sind schöne
Die Literatur hilft unter diesem Gesichtspunkt auch nur bedingt. Aber der Dichter ringt dieser Hilflosigkeit – seiner wie der der Sprache – immer wieder Schönes ab. Insbesondere deshalb sind „Die wenigen Geräusche“ von vorn bis hinten einmalige Geräusche im besten Sinne. Die Texte „Worte, schlecht gemeistert, schlecht aneinandergereiht, sich wiederholende Worte“, wie Philippe Jaccottet an einer Stelle schreibt, die den Reisenden nur noch wie ein „Schatten eines Bachs begleiten.“ (S. 127) Aber immerhin sind es Worte, Laute und Geräusche von Leben – und die aus ihnen entstehende Literatur vermag hin und wieder zu sein wie eine Katze: eine „kleine Seele in Pelzpantoffeln, nicht viel, aber dennoch.“ (S. 125)
Philippe Jaccottet: Die wenigen Geräusche. Späte Prosa und Gedichte. Hanser 2020. 160 Seiten. 23 Euro. (Bestellung)